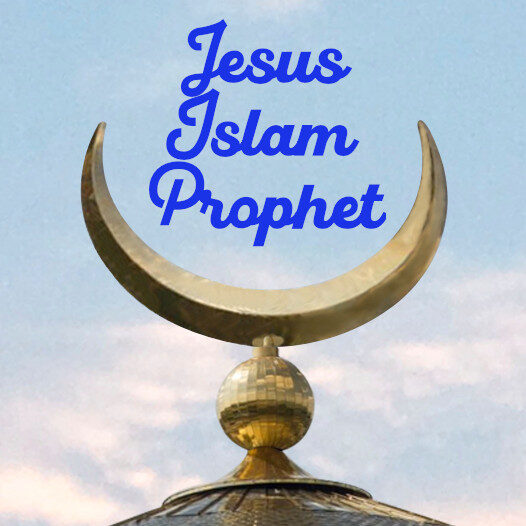Die heute noch zugängliche Literatur der Judenchristen bzw. Ebioniten ist das Barnabas-Evangelium in altitalienischer Sprache, das inzwischen in verschiedene andere Sprachen übersetzt worden ist, und die clementinische Literatur.
Das Original der clementinischen Literatur wurde von einem römischen Konsul namens Flavius Clemens in Romanform verfasst, er war mit dem römischen Kaiser Domitian verwandt, der von 81 bis 96 n. Chr. regierte.
Diese Literatur ist nur in Fachkreisen bekannt und heute nur in englischer Übersetzung zugänglich, vielleicht auch in Altgriechisch oder Latein.
In der Vergangenheit war dieser Konsul mit Clemens, dem ersten Bischof von Rom, verwechselt worden, weil beide den gleichen Namen tragen und in Rom gelebt haben.
Zunächst ging man davon aus, dass es sich bei dem Autor der clementinischen Literatur um Bischof Clemens von Rom (92-102 n. Chr.) handelte.
Nachdem man herausgefunden hatte, dass Flavius Clemens der wahre Autor war, gab man ihm den seltsamen Namen „Pseudo-Clemens“.
Flavius Clemens war ein Zeitgenosse der Apostel Petrus und Barnabas. Er berichtet, wie er den Apostel Barnabas in Rom getroffen hat, als dieser das Evangelium von Jesus auf einem öffentlichen Platz predigte. Er hat der Predigt von Barnabas aufmerksam zugehört und Gefallen an dieser neuen Religion gefunden. Daher hat er Barnabas zu sich eingeladen, damit der ihm mehr über diese Religion erzählte. Er beschloss daraufhin, sich zum monotheistischen Judenchristentum der Nazaräer zu bekehren. Dann hat er mit Barnabas vereinbart, ihn noch einmal in Palästina zu treffen, damit dieser ihn dem Apostel Petrus vorstellte.
Danach reiste Flavius Clemens nach Palästina, wo er Petrus kennen lernte. Anschließend hat er Barnabas und Petrus des Öfteren auf ihren Missionsreisen im Nahen Osten begleitet, und er hat die Predigten von Petrus und das, was er mit diesen beiden Aposteln erlebt hat, aufgeschrieben.
Die zentrale Doktrin der judenchristlichen Literatur, sei es die clementinische Literatur oder das Barnabas-Evangelium, ist die Betonung der Einheit Gottes, Jesus ist ein sterblicher Mensch, Gesandter Gottes und Prophet, und es wird ein Leben gemäß den Regeln der Thora verlangt.
Wenn Jesus manchmal in der clementinischen Literatur als „Sohn Gottes“ bezeichnet wird, dann nur im übertragenen Sinn, gemeint ist „Freund Gottes“, wie das im Alten Testament der Bibel der Fall ist. Er wird niemals als Gott betrachtet. Diese Literatur vertritt den Glauben der Ebioniten und ist gegen Paulus von Tarsus und seine Lehre gerichtet.
Das wahre Christentum ist hiernach die Wiederherstellung der monotheistischen Urreligion, die seit der Schöpfung von Gott offenbart wurde. ¹
Die clementinische Literatur besteht aus zwei Bücherserien mit ähnlichem Inhalt, den „Homilien“ (Predigten des Apostels Petrus) mit 20 Büchern und den „Recognitionen“ (Erkenntnissen) mit 10 Büchern.
Man hat diesen Büchern seltsame Namen gegeben: „pseudoclementinische Homilien“ und „pseudoclementinische Recognitionen“. In dieser Veröffentlichung werden folgende Bezeichnungen benutzt: „clementinische Homilien“ und „clementinische Recognitionen“.
Das Barnabas-Evangelium vertritt die gleiche, streng monotheistische Lehre wie die clementinische Literatur, aber es berichtet hauptsächlich über Jesus. Dieses Evangelium ist sehr viel ausführlicher als die 4 kanonischen Evangelien.
Das Barnabas-Evangelium wird von den Paulus-Anhängern abgelehnt, weil Barnabas hier Paulus von Tarsus kritisiert und weil es berichtet, dass nicht Jesus, sondern Judas Ischariot an dessen Stelle gekreuzigt wurde. Diese Aussagen sind für die Anhänger des Paulus völlig inakzeptabel, da sie ihre Heilslehre zunichte machen. Sie respektieren zwar die Persönlichkeit des Barnabas, aber dieses Evangelium betrachten sie als eine Fälschung aus dem Mittelalter. Es gibt aber eine Literaturquelle, die das Gegenteil sagt, siehe den Religionsforscher Shlomo Pines. ²
Die Existenz der clementinischen Homilien wurde erst im Jahr 1572 n. Chr. durch einen jungen Jesuiten namens Turranus wieder bekannt gemacht, er hatte intensiv in Bibliotheken geforscht, diese Bücher gefunden und sie dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie waren bis dahin verborgen gehalten worden. Das Manuskript der clementinischen Literatur wurde erstmalig 1672 n. Chr. von G. B. Cotelier in Paris veröffentlicht. ³
Diese Literatur der Judenchristen widerspricht Paulus von Tarsus und ist gegen seine Theologie gerichtet, deshalb wurde sie auch von den Anhängern des Paulus abgelehnt und als häretisch bezeichnet.
Glaubensinhalte der clementinischen Literatur 4
• Der Glaube an den Einzigen Gott.
• Jesus gilt als „großer König“ und zugleich als „der Mensch schlechthin“.
• Das Prophetentum ist nicht beendet.
• Die Beschneidung gilt als heilig.
• Befolgung des Gesetzes der Thora (des mosaischen Gesetzes).
• Heiligung des Sabbats als Ruhetag.
• Sündenvergebung durch Taufen mit vollständigem Untertauchen in Fluss oder Quelle, mit Kleidung. Das gilt auch für die
schlimmsten Sünden (es ist eine Bußtaufe, zur Reinigung von den Sünden).
• Gebetsrichtung nach Jerusalem.
• Erlaubnis, bei Verfolgung seinen Glauben zu leugnen, wenn das Herz rein und gläubig bleibt.
• Ablehnung des Paulus von Tarsus und seiner Doktrin.
• Ablehnung des Tieropfers für den Tempel von Jerusalem und des Fleischgenusses.
• Unterscheidung von göttlichen Passagen und von menschlichen Einfügungen und Veränderungen in der Thora.
• Kritik und Ablehnung einiger Stellen des Alten Testaments der Bibel.
Literatur:
1 P. Schaff, History of the Christian Church, chap. 11: The heresies of the ante-Nicene age, § 114, The Pseudo-Clementine Ebionism,
Internet : http.ccel.org/s./schaff/history/2_ch11.htm.
2 Shlomo Pines, The Jewish Christians of the early centuries of Christianity according to a new source. Die Grundschrift-Theorie,
Internet: www.barnabas-evangelium.de/die –grundschrift-theorie/.
3 Catholic Encyclopedia: Clementines.
4 E. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, Vol. II, S. 599-601, Phaidon Verlag, 1923. A Dictionary of Christian Biography and
Literature, edited by Henry Wace and William Piercy. London: John Murray, 1911. Hippolytus, IX 14-17. Epiphanius, 19 and 58.